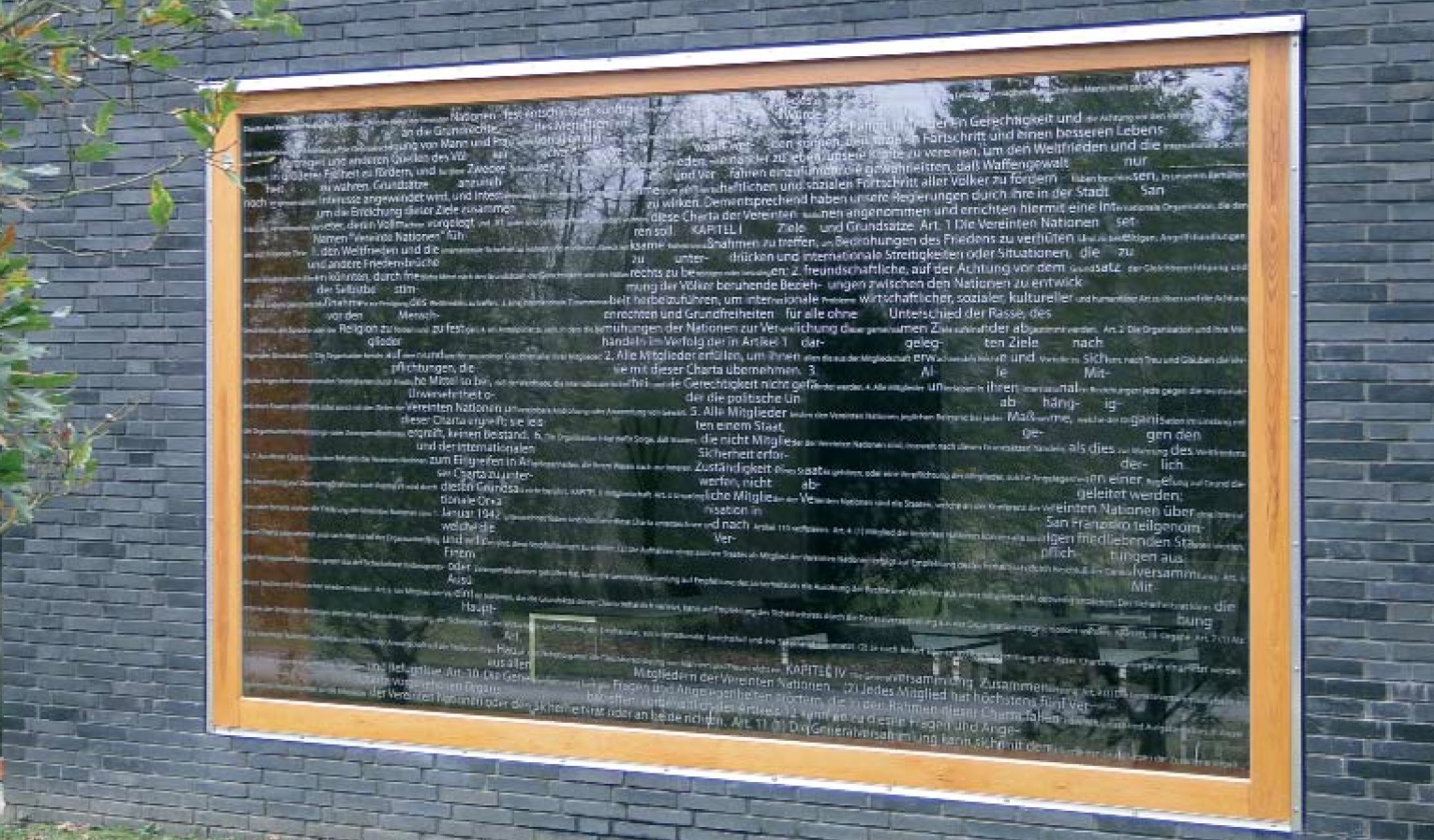ecoBKP 2025
| Material/Prozess | Vorgaben | Hinweise/Quellen |
|---|---|---|
ecoBKP 421: Gartenarbeiten | ||
Allgemeines | ||
Gestaltungskonzept |
Umgebungsgestaltungen sind integral zusammen mit Untergeschossen, Tiefbauarbeiten, Fassaden- und Dachgestaltung, Erschliessung sowie Nutzung und Unterhalt zu planen. Insbesondere sind Bestandsbäume nach Möglichkeit einzubeziehen und zu erhalten. |
Die Umgebungsgestaltung ist ein wichtiger Faktor für die klimaresiliente Siedlungsraumentwicklung. Bäume sind dabei besonders leistungsfähig; je jünger sie gepflanzt werden, desto besser können sie sich entwickeln. |
Einbezug der Nutzenden |
Die Nutzenden werden bereits während der Erarbeitung des Umgebungskonzepts einbezogen und es werden Flächen eingerichtet, welche die Interaktion der Nutzenden mit der Umgebung erlauben (Beobachtungsstellen, Urban Gardening, Kompostierplätze etc.). |
Naturnahe Gärten werden oft als verwildert angesehen. Zur Erhöhung der Akzeptanz ist der Einbezug der Nutzenden und die Information der Anspruchsgruppen wichtig. |
Pflege und Unterhalt |
Es wird ein Pflegekonzept erarbeitet, welches die differenzierte, fachgerechte Pflege der unterschiedlichen Grünflächen gewährleistet.
|
Um die Artenvielfalt zu erhalten oder zu fördern ist ein regelmässiger Unterhalt notwendig. |
Wiederverwendung von Materialien |
Bei der Gestaltung der Umgebung sind Materialien soweit möglich vor Ort wieder zu verwenden. Neue Materialien sind nur zuzuführen, wenn dies unvermeidbar ist. |
Bodenbörsen existieren in vielen Kantonen. Adressen von Verwertungs- und Entsorgungsbetrieben: |
Zertifizierung von Anlagen |
Eine Zertifizierung mit dem Label „Naturpark“ der Stiftung Natur&Wirtschaft ist anzustreben. |
Mindestanforderungen (ökologische Qualität, Freiflächen etc.): |
Befestigte Flächen und bauliche Elemente | ||
Holzauswahl |
1. Priorität: Hölzer und Holzwerkstoffe aus nachhaltiger Produktion mit Nachweis Label Schweizer Holz, FSC- bzw. PEFC-Label oder gleichwertigem Label. 2. Priorität: Hölzer und Holzwerkstoffe europäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion. nicht empfohlen: Hölzer und Holzwerkstoffe aussereuropäischer Herkunft ohne Nachweis einer nachhaltigen Produktion. |
Als europäische Länder gelten die EU- und EFTA-Mitgliedsstaaten.
|
Betonwahl (nicht klassifizierter Beton) |
Sofern technisch machbar sind Füll-, Hüll- und Unterlagsbeton, Betonfertigteile, Glas-, Stahl- und Kunststofffaserbeton mit folgenden RC-Anteilen herzustellen: 1. Priorität: Mind. 80% Betongranulat C oder Mischgranulat M. 2. Priorität: Mind. 40% Betongranulat C oder Mischgranulat M. |
Der Einfluss des RC-Anteils auf die Betonökobilanz kann mit dem Betonsortenrechner berechnet werden. |
Zementwahl |
1. Priorität: CEM III/A, CEM III/B. 2. Priorität: CEM II/A, CEM II/B-LL, CEM II/B-M, CEM II/C-M, ZN/D. |
Für Konstruktionsbeton, Füll-, Hüll- und Unterlagsbeton.
|
Befestigte Flächen |
1. Priorität: Natursteinplatten 30 mm Herkunft Schweiz, Natursteinpflästerung Herkunft Schweiz, Betonplatten 40 mm, Schotter- und Kiesrasen, Massivholzbelag, Holzpflästerung, Mergelbelag. 2. Priorität: Natursteinplatten 30 mm Herkunft Europa, Verbund-/Pflastersteine aus Beton, Rasengittersteine, Klinkersteine 50 mm. |
Sitzplätze, Gehwege, Parkplätze u.a. sind möglichst wasserdurchlässig zu gestalten. Platten und Steine sind in Splitt oder Kies zu verlegen (ungebundene Bauweise), Fugen sind offen zu lassen oder mit Sand auszufugen.
|
Sichtschutz, Sichtschutzwände |
1. Priorität: Holzwand aus Brettern oder Palisaden, Natursteine Herkunft Schweiz, Chromstahl Gitter, Stahlblech Gitter. 2. Priorität: Betonlamellen Wand, Natursteine Herkunft Europa. |
Die Begrünung von Sichtschutzwänden ist aus ökologischer Sicht zu begrüssen. |
Lärmschutz |
1. Priorität: Holzelemente (gehalten von Holz- oder Stahlstützen). 2. Priorität: Kalksandsteinmauer, Glaselemente oder Porenbetonelemente (gehalten von Stahlstützen). |
Auch mittels Terraingestaltung kann die Lärmbelastung reduziert werden. |
Stützmauern |
1. Priorität: Naturstein-Trockenmauer, Winkelplatte 15 cm, Löffelstein aus Beton (Tiefe 40-50 cm). 2. Priorität: Betonschwelle 20 cm, Spaltstein 19 cm. |
Steinkörbe werden nicht empfohlen, weil die Verzinkung zu einer Bodenbelastung führt. |
Kinderspielplätze |
Kinderspielplätze werden naturnah gestaltet. Die Spielgeräte bestehen grösstenteils aus nachwachsenden Rohstoffen. |
Spielgeräte aus Holz werden oft mit Bioziden behandelt. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit ist in solchen Fällen abzuklären. |
Entwässerungsrohre bis DN 200 |
1. Priorität: PP-Rohre SN 4/SN 8/SN 12, Steinzeugrohre, PE-Rohre SN 2/SN 4. 2. Priorität: PE-Rohre SN 8, PP-Rohre SN 16, PVC-U-Rohre SN 2/SN 4. |
Vorgabe für PVC-U-Rohre nur gültig, wenn keine umwelt- und gesundheitsrelevanten Bestandteile enthalten sind. Gussrohre weisen höhere Werte für die Graue Energie und die Treibhausgasemissionen auf als solche aus andern Materialien. |
Entwässerungsrinnen |
1. Priorität: Betonrinne mit Gusszarge, PP-Rinne. 2. Priorität: Betonrinne mit Chromstahlzarge, Polymerbetonrinne mit Gusszarge. |
Nicht empfohlen sind Rinnen mit verzinkter Stahlzarge, da die Zinkemissionen das Wasser belasten können. |
Abdeckungen für Entwässerungsrinnen, Belastungsklasse A |
1. Priorität: - 2. Priorität: Chromstahl. |
Nicht empfohlen sind Abdeckungen aus verzinktem Stahl, da die Zinkemissionen das Wasser belasten können. |
Abdeckungen für Entwässerungsrinnen, Belastungsklasse B |
1. Priorität: Polypropylen. 2. Priorität: Chromstahl. |
Nicht empfohlen sind Abdeckungen aus verzinktem Stahl, da die Zinkemissionen das Wasser belasten können. |
Abdeckungen für Entwässerungsrinnen, Belastungsklasse C |
1. Priorität: Gusseisen. 2. Priorität: Chromstahl. |
Nicht empfohlen sind Abdeckungen aus verzinktem Stahl, da die Zinkemissionen das Wasser belasten können. |
Kabelschutzrohre flexibel |
2. Priorität: PE-Rohre KRFWG, Polyolefin-Rohre KRFWG, PP-Rohre KRFWG. |
|
Regenwassermanagement | ||
Versickerung |
Unverschmutztes Meteorwasser ist wenn möglich vor Ort über eine belebte Bodenschicht versickern zu lassen. |
Z. B. Versickerungsmulde, Versickerung über die Schulter. |
Retention |
Im Rahmen des Entwässerungskonzepts sind Massnahmen zu treffen, das Regenwasser vor Ort zurückzuhalten (z.B. nicht abgedichtete Retentionsmulden, Feuchtbiotope, Retention in der Sauberwasserleitung, Regenwassernutzung, begrünte Dächer). |
|
Flora und Fauna | ||
Naturinventar |
Die bestehenden Naturwerte (Naturinventar) sind durch eine Fachperson zu erheben und die Potentiale abzuklären. Folgende Themenfelder sind dabei zu berücksichtigen: Bodenbeschaffenheit, Vegetation/Baumbestand/invasive Neophyten, Habitate von Tier- und Pflanzenarten (insbes. von geschützten bzw. bedrohten Arten), Vernetzungen, Gewässerschutz, Altlasten, Erosion, Pflegezustand. Zu betrachten sind das eigene Grundstück und die nähere Umgebung. |
Ein Naturinventar dient zum Aufzeigen des Bestands an naturnahen Lebensräumen und Objekten sowie von Defiziten und stellt die Grundlage zur Erarbeitung eines Umgebungs- und Schutzkonzepts dar. Zudem erlaubt es Rückschlüsse auf die Entwicklung von Tier- und Pflanzenarten. |
Renaturierung, ökologischer Ausgleich |
Wenig naturnahe Flächen (Parkplätze, Lagerplätze, Strassen, eingedolte Gewässer, Wasserbecken etc.) werden renaturiert und undurchlässige Belagsflächen entfernt. |
Durch die Renaturierung können die Biodiversität erhöht und das Mikroklima wesentlich verbessert werden. |
Lebensräume |
Unterschiedliche artenreiche und ökologisch wertvolle Lebensräume schaffen; z.B. Wald, Baumgruppen, Hochstammobstgärten, humusarme Freiflächen, kiesige Ruderal- oder Brachflächen, Wildblumenwiesen, Feuchtwiesen, Hecken, Staudenflure und Krautsäume, Feuchtbiotope (Tümpel, Kleingewässer, Feuchtzone), Haufen aus Natursteinen oder Totholz, Trockenmauern, begrünte Zäune und Mauern. |
Massnahmen für die Schaffung von Lebensräumen: Heft 4 „Umgebung“ aus der Reihe Ökologie am Bau des vrb: |
Ökologische Vernetzung |
In der Umgebungsgestaltung werden Vernetzungskorridore und Trittsteinbiotope (auf Basis des Inventars) geschaffen. Dies können z.B. Kleintierdurchlässe, Steinhaufen, Habitatbäume oder Totholzinseln sein. |
Viele Tierarten können nur kurze Strecken überwinden. Hindernisarme, geeignet ausgestaltete Korridore oder Trittsteinbiotope ermöglichen es solchen Arten, sich (wieder) auszubreiten. |
Schutz von Naturwerten, Baumschutz |
Die im Inventar festgestellten bestehenden Naturwerte sowie Habitate von Pflanzen und Tieren werden mit geeigneten Massnahmen geschützt.
|
Innerhalb der Abschrankungen dürfen keine Güter gelagert oder Bauinstallationen errichtet werden. |
Bepflanzung |
1. Priorität: Einheimische standortgerechte Arten (wenn möglich regionale Typen verwenden). 2. Priorität: Standortgerechte Arten. nicht empfohlen: Invasive Neophyten gemäss Schwarzer Liste (z.B. Goldrute, japanischer Stauden-Knöterich, japanisches Geissblatt, Sommerflieder, Riesen-Bärenklau etc.). |
Pflanzenliste mit Bäumen und Sträuchern: Heft 4 „Umgebung“ aus der Reihe Ökologie am Bau des vrb.
|
Dach- und Fassadenbegrünung |
Geeignete Dach- und Fassadenflächen werden begrünt und gleichzeitig Kleinstrukturen für Tiere geschaffen. |
Dachbegrünungen lassen sich mit Solaranlagen kombinieren. Es gibt verschiedene Typen der Fassadenbegrünung; bezüglich Erstellung und Unterhalt sind bodengebundene Begrünungen (z.B. mit Rankgerüsten oder Seilsystemen) vorteilhaft. |
Bodengebundene Fassadenbegrünungssysteme |
1. Priorität: Holzroste, rahmenlose Systeme aus CNS-Netzen. 2. Priorität: Rahmenlose Systeme mit CNS-Seilen und CNS-Konsolen, Roste aus glasfaserverstärktem Kunststoff. |
|
Fassadengebundene Begrünungssysteme |
1. Priorität: Substratlose Systeme aus Kunstfasergewebe auf Chromstahl-Blechprofilen. 2. Priorität: Systeme mit substratgefüllten Kunststoffbehältern auf Chromstahl-Blechprofilen. |
|
Bekämpfung von Problempflanzen |
Auf dem gesamten Areal werden keine Pflanzenschutzmittel (Biozide, Herbizide) eingesetzt.
|
Gemäss ChemRRV ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Dächern, Terrassen und Wegen verboten. |
Nisthilfen |
Es werden geeignete Nisthilfen für verschiedene Tierarten (z.B. Insekten, Vögel, Fledermäuse, Bilche) geschaffen. |
Nisthilfen erleichtern den Tierarten die Ansiedlung. Sie müssen exakt auf die Bedürfnisse der entsprechenden Tierart abgestimmt sein. |
Vermeidung von Tierfallen |
Roste von Licht- und Lüftungsschächten sind mit einem Gitternetz (Maschenweite max. 5 mm) zum Schutz von Tieren abzudecken.
|
Merkblatt Koordinationsstelle für Amphibien- u. Reptilienschutz CH:
|
Lichtemissionen |
Die Beleuchtung ist so zu planen, dass Licht nur dorthin gelangt, wo es einen funktionalen Zweck erfüllt. Beleuchtungsdauer und Lichtstärke sind auf das funktional Notwendige reduzieren, Beleuchtungszeiten sind den saisonalen Gegebenheiten anpassen, in Naturschutzgebieten und ökologisch empfindlichen Landschaftsräumen ist möglichst auf künstliche Beleuchtung verzichten. |
Unnötige Lichtemissionen aus Beleuchtungsanlagen führen zur Beeinträchtigung von Ökosystemen, zum Tod von Tieren und zu Umweltbelastung (Stromverbrauch). |
Weitere Vorgaben in anderen ecoBKP | ||
Abbrüche/Rückbau |
Wiederverwendung / Verwertung. |
|
Baustelleneinrichtung |
Installationsplanung (Baumschutz, Gewässerschutz, Luftreinhaltung, Baulärm). |
|
Baugrubenaushub |
Bodenschutz, Maschineneinsatz, Erdarbeiten, Verwertung/Entsorgung. |
|
Baumeisterarbeiten |
Betonzusatzmittel, Schalung. |
|
Montagebau in Stahl |
Stahlteile, Korrosionsschutz. |
|
Montagebau in Holz |
Holzschutz und Holzauswahl. |
|
Bedachungsarbeiten |
Dachbegrünungen |
|